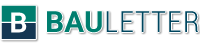Bauletter, BAULINKS.de-Meldungen, vom 23.9.2009
Windkraftanlagen,
Solarzellen, Flugzeuge, Autos - die Wissenschaft verspricht sich
viel von Nanoröhrchen und ihren erstaunlichen Eigenschaften: Mit
den ultradünnen Röhrchen aus Kohlenstoff kann das Spektrum an
Eigenschaften von Kunststoffen erheblich erweitert werden. Carbon
Nanotubes machen Kunststoffe stabiler, haltbarer und elektrisch
leitfähig. Vom 20. bis 23. September stand dieser neue
Verbundwerkstoff im Zentrum der vierten
International
Conference on Carbon Based Nanocomposites an der
TU Hamburg-Harburg.
Die TUHH zählt auf diesem Forschungsgebiet weltweit zu den
führenden
Universitäten. Die Verbesserung von Kunststoffen durch
den Einsatz von Kohlenstoff-Nanoröhrchen beschäftigt seit mehr als
zehn Jahren Professor Karl Schulte sowie eine Reihe weiterer
Wissenschaftler der TUHH. Der Werkstoffexperte ist außerdem
Sprecher des wissenschaftliches Beirates des Forschungsverbundes "Inno.CNT",
ein "Leuchtturmprojekt" des BMBF, das der Bund mit 40-Millionen
Euro fördert und an dem mehr als 70 Universitäten,
Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen beteiligt sind.
Weitere 40 Millionen Euro steuern die beteiligten
Industrieunternehmen zu. "Es geht darum, die grundlegenden
Kenntnisse des vergangenen Jahrzehnts in wirtschaftliche Produkte
zu übertragen", sagt Schulte. Über 600.000 Euro stehen seinem Team
in den kommenden vier Jahren dafür zur Verfügung.
Nanomaterialien zeigen besondere Eigenschaften und sind mehr
als zehntausend Mal dünner als ein menschliches Haar (Durchmesser
1-20 Nanometer). So können Kunststoffe, die mit den ultradünnen
Kohlenstoff-Nanoröhrchen auf molekularer Ebene verstärkt werden,
schon bei geringsten Anteilen eine erhöhte Belastbarkeit und
elektrische Leitfähigkeit aufweisen. Dadurch eröffnen sich
zugleich neue Einsatzgebiete. Der Verbundwerkstoff ist nicht
allein für Unternehmen aus der Windkraft-, Flugzeug- und
Automobilindustrie interessant, sondern auch für die chemische
Industrie, Bau- und Elektronikbranche sowie Unternehmen des
Maschinenbaus. Vorraussetzung für die potenzielle Nutzung ist ein
grundlegendes und umfassendes Wissen über die Herstellung,
Verarbeitung und Eigenschaften dieses Nanomaterials.
Um Forschung und stabile Baustoffe geht es auch heute im
Bauletter:
|
() |
Deutsche Bauchemie bietet "Aktionspaket
Beton-Fachinformationen" an
Die
Deutsche Bauchemie hat für interessierte Planer, Architekten, für Vertreter
ausschreibender Stellen und Behörden sowie für Anwender aus
Bauindustrie
und Baugewerbe ein Aktionspaket zum Vorzugspreis mit acht
Fachinformationsbroschüren rund um die Betontechnologie /
Bauchemie
geschnürt.
|
|
() |
DLR sucht für Aerogelbeton Kooperationspartner
Das
Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat im Rahmen von
Forschungsarbeiten einen
Leichtbeton
mit herausragenden Eigenschaften hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit, Dichte und
Dämmeigenschaften entwickelt. Der so genannte "Aerogelbeton" erhält seine
Charakteristik durch die Zugabe von Aerogelen (auch als
Nanogel
bekannt) in die
Zementmischung.
|
|
() |
Bauforschung: Mauersteine aus dem Klärwerk
Das
Institut für Umwelttechnik und Management an der Universität Witten/Herdecke
entwickelt einen neuartigen
Mauerstein "EcoBrick".
Er soll mit Energie und Reststoffen aus der
Abwasserklärung hergestellt werden.
|
|
() |
dena-Modellvorhaben: Aufstockung mit Poroton-T8
Im Rahmen einer energetisch hocheffizienten Gebäudesanierung feierten die
Bauherren eines Berliner Gründerzeithauses Anfang August Richtfest für ein neues
Staffelgeschoss. Das 1886 erbaute Wohnhaus in Berlin Steglitz soll nach der
Sanierung einen Jahres-Primärenergiebedarf von nur noch 38 kWh/m² pro Jahr haben
und benötigt dann rund 85 Prozent weniger Primärenergie als vorher.
|
|
() |
Lückenbebauung mit zugeschnittenem Porenbeton: Vorbilder
zeitgemäß interpretiert
Baulücken
in der Altstadt sind eine Seltenheit, schließlich hat die Sanierung der
historischen Bausubstanz oberste Priorität. Doch im Zentrum von Lübeck bot sich
die Möglichkeit, mit einem modernen Altstadthaus die Blockrandbebauung zu
ergänzen.
|
|
() |
Ökologisches Qi-Designhaus mit Cabrio-Dach bis
Champagner-Keller
Energieeffizienz und Ökonomie muss und wird auch beim Hausbau groß
geschrieben. Gleichzeitig darf es aber nicht an Design oder Fortschritt fehlen.
Energie sparen, aber nicht auf außergewöhnliche Gestaltung verzichten - ist das
möglich? Der Allgäuer
Holzhaus-Spezialist
Baufritz befasst sich Jahren mit diesem vermeintlichen Spagat.
|
|
() |
Räume auf Zeit rund um den Schulhof
Das Konjunkturpaket II ermöglicht aktuell vielen Schulträgern die Sanierung
ihrer zum Teil maroden Schulgebäude. Aber nicht immer lassen sich die
notwendigen baulichen Maßnahmen in den Ferien erledigen. Und so werden Klasse
für Klasse oder Flur für Flur Ausweich-Klassenzimmer benötigt - das Metier von
Herstellern und Anbietern mobiler
Raummodule - wie beispielsweise
C/S RaumCenter.
|
|