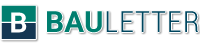Bauletter, BAULINKS.de-Meldungen, vom 20.8.2009
Seit mehreren Jahren beschäftigen sich Wissenschaftler der
Forschungsgruppe Baubotanik am
Institut Grundlagen Moderner Architektur und Entwerfen (Igma) der
Universität Stuttgart damit, Tragstrukturen aus lebenden Holzpflanzen zu
bilden. Kürzlich konnte der erste baubotanische Turm aus lebenden Bäumen
fertig gestellt werden. Das in der Gemeinde Wald zwischen Stockach und
Pfullendorf errichtete prototypische Bauwerk ermöglicht praxisnahe Tests,
von denen sich die Gruppe um Institutsleiter Prof. Gerd de Bruyn
Fortschritte für die Forschung erwartet.
Der knapp neun Meter hohe Turm mit einer Grundfläche von etwa
acht Quadratmetern veranschaulicht die architektonischen und
ökologischen Potentiale der Baubotanik: Bäume leisten durch ihren
Stoffwechsel einen wichtigen Beitrag zum Mikroklima unserer Städte
und bereichern mit ihrem Erscheinungsbild unseren Alltag - meist
vergehen jedoch Jahrzehnte, bis ein Baum voll ausgebildet ist.
Ziel baubotanischer Forschung ist es, lebende pflanzliche
Strukturen als frei formbare, architektonische Baum-Tragwerke in
der Dimension ausgewachsener Bäume zu konstruieren. In kurzer Zeit
können so Grünräume gebildet werden, die die ästhetischen und
ökologischen Qualitäten von Bäumen mit baulichen
Nutzungsfunktionen verbinden.
Ein Organismus aus mehreren hundert Pflanzen Basis des Turms
ist eine fachwerkartige Struktur aus mehreren hundert jungen, nur
zwei Meter großen Silberweiden. Nur die untersten Pflanzen wurden
in den Erdboden gesetzt, alle anderen wurzeln in von einem
temporären Stahlgerüst getragenen Pflanzcontainern (siehe Bild auf
Twitter bzw. Twitpic:
http://twitpic.com/eouxk). Die Stuttgarter Architekten nutzen
dabei eine alte Erfahrung: Pflanzen gleicher Art können durch mit
dem "Pfropfen" verwandten Methoden zu einem einzigen Organismus
verwachsen. Wenn die untersten Pflanzen des baubotanischen Turms
in wenigen Vegetationsperioden ein leistungsfähiges Wurzelsystem
im Erdboden entwickelt haben, werden die Pflanzcontainer entfernt.
Im Rahmen seiner Promotion konnte Ferdinand Ludwig vom Igma in
Versuchen zeigen, dass und wie diese Verwachsungsmethode
funktioniert.
Noch in diesem Jahr sollen die Pflanzen des Turmes durch ihren
Austrieb eine grüne Wand ausbilden, und im weiteren Verlauf der
Entwicklung werden die momentan noch sehr dünnen Stämme immer
dicker. Sobald die lebende Struktur stabil genug ist, um die drei
einwachsenden Ebenen aus verzinktem Stahl tragen und die
Nutzlasten des Bauwerks übernehmen zu können, wird das Gerüst
entfernt. Wie lange dieser Prozesse dauern wird, hängt von vielen
Faktoren ab und soll an diesem Turmbauwerk untersucht werden -
gerechnet wird mit einer Zeitspanne von fünf bis zehn Jahren.
Das Pilotprojekt Turm entstand im Rahmen der Promotion von
Ferdinand Ludwig bei Prof. Gerd de Bruyn (Igma,
Universität Stuttgart) und Prof. Thomas Speck (Plant
Biomechanics Group Freiburg, Universität Freiburg) in
Zusammenarbeit mit dem Bildhauer
Cornelius Hackenbracht (Neue Kunst am Ried, Wald-Ruhestetten).
Das Projekt wird von der
Bundesstiftung Umwelt, zahlreichen Fachbetrieben,
Ingenieurbüros und weiteren Sponsoren unterstützt.
Am 19. September 2009 soll der Turm der Öffentlichkeit
vorgestellt. Bis dahin müssen Ihnen u.a. die folgenden Beiträge
zur Gebäudefassade genügen:
|
() |
Forschungsauftrag für neue Fassadenbeschichtungen
Das
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert im Rahmen
ihrer Hightech-Strategie das Forschungsprojekt "Helioclean". Dieses Projekt, an
dem u.a die Löninger Firma
Remmers Baustofftechnik beteiligt ist, bündelt die Kompetenzen von drei
Universitäten und fünf Industriepartnern.
|
|
() |
Siliconharzfarben im Denkmalschutz
Knapp 40 Jahre nach der ersten Restaurierung mit Kaseinfarben war es 2005 an der Zeit, die
Sandsteinfassade vom "Breiten Herd" in Erfurt ein weiteres Mal komplett zu restaurieren.
Dieses Mal wurden allerdings
Siliconharzfarben verwendet, die sowohl wasserabweisend als auch atmungsaktiv sind
(und die 1969 noch gar nicht zur Verfügung standen).
|
|
() |
Holzfaserdämmplatten wissenschaftlich untersucht
Je mehr Holzfaserdämmplatten wiegen, desto besser ist ihr tatsächliches
Wärmedämmvermögen im Vergleich zu dem für die Berechnung anzusetzenden
Wärmedämmvermögen. Auf diesen einfachen Nenner lassen sich offensichtlich die
Ergebnisse des wissenschaftlichen Forschungsprojekts "InnoNet" bringen, das
unter realitätsnahen Bedingungen vom
Wilhelm-Klauditz-Institut für
Holzforschung in Braunschweig durchgeführt
wurde.
|
|
() |
Neue nachhaltige, naturbraune Mineralwolle-Technologie
Knauf Insulation bietet ab Mitte 2009 neue natürliche
Dämmstoffe mit ECOSE-Technology an - einer neuen
Bindemittel-Technologie, die auf erneuerbaren Rohstoffen basiert. Neben der
insgesamt verbesserten Energiebilanz des Dämmstoffs verspricht sie auch
Verarbeitungsvorteile.
|
|
() |
Stahl-Innovationspreis für Fassaden-Abstandhalter
Fassadenbekleidungen, wie z.B. Bauelemente aus
Stahlblech oder
Natursteinplatten, benötigen eine Unterkonstruktion für ihre
Befestigung. Gerade
bei der Altbausanierung sind hoch effiziente Bauteile gefragt, die sich an
unebene Wände und Versprünge leicht anpassen lassen.
Contrial entwickelte den leichten, beim Stahl-Innovationspreis 2009
ausgezeichneten Fassadenhalter "ConArc", der eine flexible und schnelle Montage
ermöglicht und dabei äußerst stabil und energieeffizient ist.
|
|
() |
Flächenbündige Bauskulptur aus Fenstern und ArGeTon
Das Gooiland liegt zwischen Amsterdam, Amersfoort und Utrecht. Die Region ist
von Heide, Wald, Wiesen und kleinen Seen geprägt. Die dortigen Bewohner sind
stolz auf ihre Heimat und das traditionelle Bild ihrer Ortschaften. Als
Architekt Koen van Velsen aus Hilversum den Auftrag erhielt, dort einen modernen
Büroneubau zu errichten, wurde er alsbald mit den Forderungen der Baubehörde und
der organisierten Nachbarschaft konfrontiert.
|
|
() |
In Schiefer gehüllte "Petersburg" mit
"Schiefer-Solarkollektor"
Am Rande eines malerischen Ortes in der Schweiz, mit Blick auf die Alpen,
steht dieses ungewöhnliche
Einfamilienhaus. Die Eigentümer sind passionierte
Bergwanderer und Gesteinsliebhaber ... und so liegt ihr Haus wie ein Findling am
Ortsrande. Fassade und Dach sind mit grünem ColorSklent-Schiefer von
Rathscheck Schiefer gedeckt.
|
|
() |
Ville Verdi: Vorzeigeprojekt mit ReflectionsCinc
Ville Verdi heißt eine Wohnanlage in Wien, bei dem Bauherr und Architekt neue
ästhetische Akzente setzen wollten. Sofort ins Auge fallen die ungewöhnliche,
leicht geneigte Silhouette der Bauten und ihre grünen
Fassade.
Hoesch Bausysteme, eine österreichische Tochtergesellschaft der
ThyssenKrupp Steel AG, liefert mehr als 14.000 Quadratmeter Hoesch
Wellprofile, Hoesch Trapezprofile und Hoesch Sidingfassade Planeel.
|
|